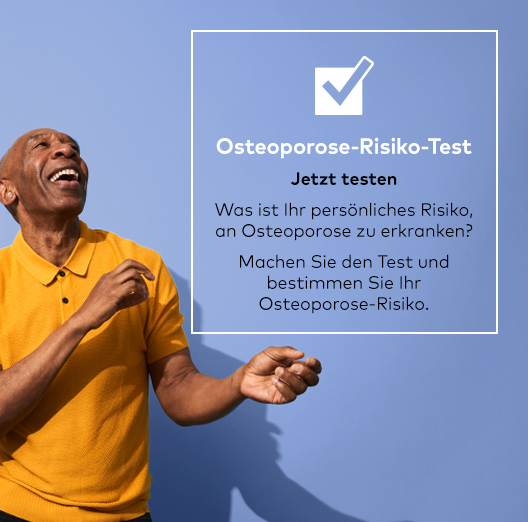Diagnose der Osteoporose
Wonach Sie Ihr Arzt fragen wird

Damit der Arzt Ihr Osteoporose-Risiko besser einschätzen kann, wird er Sie zunächst um folgende Informationen bitten:
- Persönliche Angaben (darunter Gewichts- / Grössenentwicklung seit der Jugend oder eine mögliche familiäre Vorgeschichte von Knochenbrüchen / Osteoporose)
- Risikoprofil anhand eines von Ihnen ausgefüllten Risikotests
- Medizinische Vorgeschichte
- Knochenbrüche als Erwachsener
- Stürze
- Essstörungen (Anorexia nervosa) oder Unverträglichkeiten (Laktoseintoleranz)
- Schilddrüsenerkrankungen
- Alltagsgewohnheiten
- Ernährungsgewohnheiten
- Bewegung / physische Aktivität
- Häufigkeit der Sonnenbestrahlung
- Rauchen
- Alkoholkonsum
- Bei Frauen: Menstruation und Menopause
- Regelmässigkeit der Periode
- Wechseljahre
- Bei Männern: zum Beispiel nach einer Hormontherapie bei Prostatakrebs
Machen Sie daher vor Ihrem Arztbesuch z.B. ein Bewegungsprotokoll über den Zeitraum von ca. 2 Wochen. Notieren Sie, welche Tätigkeiten Sie am Tag ausführen: z.B. Einkaufen, Putzen, Spazierengehen, Sport treiben, Fernsehen schauen. Diese Informationen sind für Ihren Arzt wichtig zur Ermittlung Ihres persönlichen Osteoporose-Risikos.
Weitere Themen

Ursachen und Risikofaktoren der Osteoporose
Viele knochenschädigende Zusammenhänge sind durch die Lebensweise beeinflussbar.
Mehr lesenUntersuchungen und Diagnosestellung
Knochendichtemessung (Knochendensitometrie)
Die Knochendichtemessung (Knochendensitometrie) ermöglicht eine Diagnose bereits, bevor es zum ersten Knochenbruch kommt. Dieses Verfahren untersucht den Mineralstoffgehalt des Knochens (Knochendichte), denn dieser bestimmt massgeblich die Festigkeit des Knochens. Eine verminderte Knochendichte bedeutet somit eine erhöhte Brüchigkeit der Knochen.

Die am häufigsten verwendete Methode der Knochendichtemessung ist die Doppel-Energie-Röntgenabsorptiometrie (DEXA). Während man angekleidet auf dem Untersuchungstisch liegt, wird von einer speziell ausgebildeten medizinischen Praxisassistentin üblicherweise die Wirbelsäule und/oder die Hüfte untersucht – also die Orte, an denen die Knochenbruchgefährdung am grössten ist. Verwendet wird nur eine geringe Dosis an Röntgenstrahlen, wobei die Strahlendosis nur unwesentlich grösser ist als diejenige, die natürlicherweise in der Umwelt vorliegt. DEXA-Messungen sind daher für Patientinnen und Patienten völlig harmlos. Nach kurzer Zeit werden die Daten der nur wenige Sekunden dauernden Messung durch den angeschlossenen Computer ausgewertet.
Bei einer Knochendichte zwischen 10% - 25% unter der mittleren Knochendichte junger Gesunder spricht man von einer Osteopenie, einer Vorstufe der Osteoporose. Ohne Behandlung kann sie mit zunehmendem Alter in eine Osteoporose übergehen. Eine Osteoporose liegt dann vor, wenn die gemessene Knochendichte 25% und mehr unter der durchschnittlichen Knochendichte junger Gesunder des gleichen Geschlechts liegt.
Im Verlaufe einer Osteoporose-Behandlung kann die DEXA-Messung zur Kontrolle gefahrlos wiederholt werden. Damit ist es möglich, den Therapieerfolg anhand des Zuwachses der Knochendichte abzuschätzen.
Knochendichtemessungen kann man in speziellen DEXA-Zentren durchführen lassen. Die Kosten für eine Knochendichtemessung mittels DEXA belaufen sich mit Beratung auf ca. 80 - 250 CHF und werden zurzeit unter folgenden Voraussetzungen von den Krankenkassen übernommen:
- Klinisch manifeste (d.h. Symptome verursachende) Osteoporose
- Nach Knochenbruch mit inadäquatem Trauma (d.h. ohne grobe Einwirkung)
- Bei einer Langzeit-Kortisontherapie oder Hypogonadismus
- Magen-Darmerkrankungen (schlechte Nährstoffaufnahme im Darm, Morbus Crohn, Colitis ulcerosa)
- Nebenschilddrüsenüberfunktion (Primärer Hyperparathyreoidismus)
- Osteogenesis imperfecta (Glasknochenkrankheit)
- HIV
Wenn diese Voraussetzungen bei Ihnen nicht vorliegen, fragen Sie vorab bezüglich einer Kostenerstattung bei Ihrer Krankenkasse nach. Eventuell werden die Kosten über eine Zusatzversicherung abgedeckt.
Bestimmung des 10-Jahres-Frakturrisikos
Anhand der gemessen Knochendichte und den Risikofaktoren einer Person, kann der Arzt das Risiko errechnen, innerhalb der nächsten 10 Jahre einen Osteoporose-bedingten Knochenbruch zu erleiden („10-Jahres Risiko für eine typisch Osteoporose-bedingte Fraktur“). Dieses Risiko kann anhand eines speziellen Berechnungsmodells („fracture risk assessement tool“, FRAX®) berechnet werden. Ist das 10-Jahres-Fraktur-Risiko 25% oder grösser, oder besteht bereits ein Osteoporose-bedingter Knochenbruch, wird eine Osteoporose-Therapie empfohlen.

Quantitative Computertomografie und Ultraschall
Zur Knochendichtemessung kann auch in bestimmten Fällen die quantitative Computertomographie gerechtfertigt sein. Diese Untersuchungsmethode ist präziser als die DEXA-Messung, weist jedoch eine höhere Strahlenbelastung auf. Dagegen ist die Ultraschallmessung einfach anzuwenden und sie belastet den Körper nicht mit Strahlen. Mit ihr kann man jedoch die Knochendichte nicht messen, aber sie liefert Hinweise auf die Bruchgefahr des Knochens. Die Ultraschallmessung kann die DEXA-Messung insbesondere in der Wirbelsäule und der Hüfte jedoch nicht ersetzen. Beide Verfahren sind im Moment für den Einsatz in der Routine noch zu wenig standardisiert.

Röntgen bei Vorliegen eines Knochenbruchs
Röntgenbilder der Wirbelsäule lassen Verformungen, wie sie für osteoporotische Knochenbrüche typisch sind, meist auf Anhieb erkennen. Kommt es, ohne Unfall, zu einem Wirbelkörper- oder Schenkelhalsbruch, so kann das Röntgenbild einen Hinweis aufzeigen. Bei akuten oder chronischen Rückenschmerzen unklarer Ursache, z.B. bei einem Verdacht auf Wirbelkörperbrüche, ist eine Röntgenuntersuchung der Wirbelsäule grundsätzlich sinnvoll.
Zur Früherkennung einer Osteoporose ist eine Röntgenaufnahme hingegen nicht geeignet, da eine Osteoporose auf Röntgenbildern nur erkannt werden kann, wenn die Knochenmasse bereits um 30-40% vermindert ist oder sogar schon Knochenbrüche aufgetreten sind. Auch für die Abklärung des Osteoporose-Risikos eignet sich eine Röntgenuntersuchung nicht.

Laboruntersuchungen
Der Zweck von Laboruntersuchungen des Blutes und Urins im Rahmen der Osteoporoseabklärung besteht vor allem darin, eine sekundäre Osteoporose auszuschliessen oder nachzuweisen sowie darin, andere Knochenstoffwechselerkrankungen mit erhöhter Frakturgefahr zu erkennen. Bis zu einem gewissen Grad können Laborbefunde auch bei der Beurteilung des Verlaufs einer Osteoporose hilfreich sein.
Weitere Themen

Osteoporose-Risikotest
Habe ich Osteoporose? Testen Sie Ihr persönliches Osteoporose-Risiko.
Zum Test
Therapie der Osteoporose
Durch gezielte Massnahmen kann das Fortschreiten der Krankheit aufgehalten werden.
Mehr lesen